 Vorweggenommen, bei der Auswanderung der Hugenotten handelt es sich nicht um eine klassische Völkerwanderung. Dennoch waren es geschätzte 500 000 Menschen, die ihrer französische Heimat Ende des 17. Jahrhunderts für immer den Rücken kehrten; für damalige Zeiten eine überaus große Menschenmenge. Hinzu kommt, dass diese Auswanderungswelle eines der positivsten Beispiele für eine wohl gelungene Integration von Menschen aus einem anderen Sprach- und Kulturkreis darstellt.
Vorweggenommen, bei der Auswanderung der Hugenotten handelt es sich nicht um eine klassische Völkerwanderung. Dennoch waren es geschätzte 500 000 Menschen, die ihrer französische Heimat Ende des 17. Jahrhunderts für immer den Rücken kehrten; für damalige Zeiten eine überaus große Menschenmenge. Hinzu kommt, dass diese Auswanderungswelle eines der positivsten Beispiele für eine wohl gelungene Integration von Menschen aus einem anderen Sprach- und Kulturkreis darstellt.
Der Humanismus hatte auch in Frankreich der Reformation den Boden bereitet, so dass schon 1523 die erste lutherische Bewegung entstand. Die Verfolgung seiner Anhänger durch König Franz I. (1494-1547) sowie dessen Sohn Heinrich II. (1519-1559) lies an Stelle des Luthertums die streitbare Lehre Calvins treten.
Johannes Calvin (1509-1564) war neben Martin Luther der bedeutendste Reformator im 16. Jahrhundert. Im Jahr 1536 musste er seine Heimat Frankreich verlassen, weil er sich in seinem Buch Institutio Christianae Religionis gegen die katholische Lehre und damit gegen das Papsttum gewandt hatte. Seine Lehre, der Calvinismus, verbreitete sich ab 1545 relativ rasant bei Handwerk, Bürgertum und auch dem Adel und führte von 1562 bis 1598 zu einem blutigen Bürgerkrieg in Frankreich, dem Hugenottenkrieg.
Ab etwa 1560 war für französische Protestanten im vorrevolutionären Frankreich die Bezeichnung Hugenotten gebräuchlich. Die Herkunft dieses Wortes ist nicht zweifelsfrei geklärt, eine Ableitung vom frühhochdeutschen Begriff Eidgenossen (eygenot) wird jedoch angenommen.
Nach zahlreichen Übergriffen durch die katholische Staatsmacht mit ihrer Armee auf die Hugenotten, kam es am 23./24. August 1572 zur Bartholomäusnacht. Dieses Massaker an französischen Hugenotten wird auch Pariser Bluthochzeit genannt. Admiral Gaspard de Coligny und weitere Führer der französischen Protestanten wurden dabei auf Befehl der Königinmutter Katharina von Medici ermordet. Die Protestanten waren Gäste der Hochzeit des Protestanten Heinrich von Navarra (des späteren Königs Heinrich IV.) mit Katharinas Tochter Margarete von Valois. Die Zahl der Todesopfer betrug in Paris etwa 3.000 und auf dem Lande zwischen 10.000 und 30.000. Das Morden an Kindern, Frauen, Alten und Jungen ging aber noch zwei lange Monate weiter. Es folgte eine erste größere Fluchtwelle von Hugenotten in umliegende europäische Länder.
Heinrich IV. (Heinrich von Navarra), der selbst nach seiner Thronbesteigung vom Protestantismus zum Katholizismus konvertieren musste, um sich endgültig in Frankreich durchzusetzen, und der nach seinem Sieg über die ihn bekämpfende Katholische Liga das Land zu befrieden versuchte, unterzeichnete 1598 das Edikt von Nantes. Es gewährte den Calvinisten Gewissensfreiheit und die freie Religionsausübung in der Öffentlichkeit, ausgenommen in Paris und Umgebung sowie in Städten mit Bischofssitz oder königlichen Schlössern.
Es trat für 30 Jahre eine gewisse Beruhigung der Lage in Frankreich ein. Unter den regierenden Ministern Kardinal Richelieu und Kardinal Mazarin begann sich die Lage für die Hugenotten erneut zu verschärfen. Als Sonnenkönig Ludwig XIV. 1661 die Regierung übernahm leitete er eine groß angelegte, mit Bekehrungs- und Missionierungsaktionen verbundene, systematische Verfolgung der Protestanten ein, die er aufgrund der einsetzenden Flüchtlingswellen 1669 mit einem Emigrationsverbot verband und die schließlich ab 1681 in den berüchtigten Dragonaden ihren Höhepunkt fanden. Als solche werden die Strafmaßnahmen bezeichnet, die Ludwig XIV. gegen die Hugenotten einführte, um diese zurück zum katholischen Glauben zu zwingen. Diese Bezeichnung wurde von den Dragonern abgeleitet, die besonders in den südfranzösischen Landschaften, zwangsweise bei den Hugenottenfamilien einquartiert wurden. Diese mussten die Dragoner so lange verpflegen und versorgen, bis sie zum Katholizismus zurückkehrten. Anscheinend fruchteten selbst diese Zwangsmaßnahmen nicht ausreichend, so dass Ludwig XIV. 1685 das Edikt von Nantes widerrief – der Protestantismus/Calvinismus war somit faktisch wieder verboten. Das weitere Anhängen am reformierten Glauben sowie die Auswanderung der Hugenotten wurde in der Folge mit Galeerenstrafe bedroht. Das war eine äußerst harte und grausame Strafe. Die Sträflinge wurden mit Ketten an die Ruderbänke der Galeeren angeschlossen und mussten dort Tag und Nacht, ohne die Ketten abgenommen zu bekommen, die Riemen der Schiffe bedienen.
Alle Maßnahmen, die Hugenotten zu bekehren zum katholischen Glauben zurückzukehren, brachten Ludwig XIV. jedoch wenig Erfolg. 1687 setzte eine gewaltige Flüchtlingswelle der Hugenotten ein. Die Réfugiés (Flüchtlinge) flohen in die europäischen Länder, die inzwischen die reformierte Lehre angenommen hatten oder aber gleichberechtigt neben dem Katholizismus akzeptierten. Daher suchten viele Hugenotten auch Zuflucht in deutschen Herrschaftsbereichen, vorzugsweise in Rheinpfalz, dem Kurfürstentum Brandenburg, in Hessen, der Markgrafschaft Brandenburg-Bayreuth und in Mecklenburg.
Im Folgenden möchte ich mich nun ausschließlich der Einwanderung der Hugenotten in das Kurfürstentum Brandenburg zuwenden und dabei insbesondere dem Fürstentum Halberstadt. Dafür gibt es zwei Gründe: Zum einen würde es zu weit führen alle Hugenottenströme zu verfolgen, zum anderen habe ich mich intensiv mit der Einwanderung nach Halberstadt auseinandergesetzt, wodurch ich hoffentlich im Weiteren noch einige interessante Aspekte anführen kann.
Halberstadt, dass durch den Westfälischen Friede als Fürstentum zum Kurfürstentum Brandenburg gekommen war, hatte außergewöhnlich stark unter den Auswirkungen des Dreißigjährigen Krieges gelitten. Die Bevölkerung der ehemaligen Bischofsstadt war äußerst stark dezimiert worden. Noch erheblich drastischer hatte es Magdeburg getroffen. Durch die Magdeburger Hochzeit (Zerstörung der Stadt durch die kaiserlichen Truppen unter Tilly und Pappenheim im Mai 1631) waren von den einstmals etwa 35 000 Einwohnern 1639 nur noch etwa 450 Menschen übrig geblieben.
Kurfürst Friedrich Wilhelm III. hatte diese Situation fest im Auge, die auch andere Städte seiner Herrschaft, wie Berlin und Potsdam betraf, als er am 08. November 1685 das Edikt von Potsdam erließ. Mit diesem Erlass lud der Kurfürst 20.000 Hugenotten nach Brandenburg ein, um sich dort nieder zu lassen. Die französischen Réfugiés nahmen das Angebot des deutschen Kurfürsten gern an und zogen in das Kurfürstentum Brandenburg.

Frankreich verlor mit den Auswanderern, was die anderen – so auch Brandenburg – gewannen: Neben vielen tüchtigen Kaufleuten, Seeleuten (die Hugenotten galten als die besten Seeleute Frankreichs), Ärzten und Wissenschaftlern, kamen auch hochqualifizierte und spezialisierte Handwerker sowie Bauern nach Brandenburg. Der Große Kurfürst hatte wohl eine Vision! Jedoch musste er zunächst seine Bevölkerung auf die Einwanderungswelle vorbereiten, denn seine Untertanen hatten selbst noch extrem unter den Nachwirkungen des Dreißigjährigen Krieges zu leiden.
Besonders für Halberstadt wurde es eine äußerst schwere Zeit, denn der Kurfürst hatte die Stadt als zentralen Anlaufpunkt für alle Hugenotten, die aus Frankreich nach Kurbrandenburg einreisten, vorgesehen. Dort wurden die Hugenotten kurzfristig aufgenommen, versorgt und verpflegt und dann geordnet in vorgesehene Städte und Regionen weiter geleiten. Da zeigen sich Analogien zu heute auf, denn auch jetzt ist Halberstadt zentrale Anlaufstelle für Flüchtlinge in Sachsen-Anhalt. Allein die Versorgung und Weiterleitung der vielen Flüchtlinge brachte immer neue, erhebliche Schwierigkeiten, mit denen sowohl die Halberstädter Regierung wie auch die Bevölkerung fertig werden mussten.
Im November 1687 erließ daher der Kurfürst einen Befehl an die Regierung des Halberstädter Fürstentums, wonach eine allgemeine Steuer von allen Bürgern einzutreiben sei. Diese Steuer ging jedoch nur sehr zaghaft ein, so dass diese von kurfürstlichen Beamten erst „nachdrücklich“ eingetrieben werden musste.
Diese Zeit muss extrem schwer für Halberstadt gewesen sein. Die halberstädter Bürger, wie auch die die Landbevölkerung in den umliegenden Dörfern, führte einen eigenen Überlebenskampf und musste dennoch tausende Flüchtlinge versorgen. Daher schrieb H. Tollin in seiner dreibändigen Arbeit über die „Geschichte der französischen Kolonie in Magdeburg“ (1887): „…..wenn man es irgendeiner Stadt verzeihen kann, dass sie sich zur Daueraufnahme von andersgläubigen Franzosen nicht hervordrängte, so ist es Halberstadt…“.
Daher dauerte es auch 14 Jahre, bis sich in Halberstadt eine erste Hugenotten-Gemeinde zu bilden begann. Den Anfang machten im Jahr 1700 etwa 50 Familien mit zusammen ca. 175 Personen, die vorrangig aus der französischen Schweiz kamen. Obwohl die halberstädter Stände genug eigene Sorgen und Probleme hatten, taten sie ihr Möglichstes um, um den Flüchtlingen zu helfen. So wurden neben Geld- und Sachspenden auch Äcker für die Hugenotten bereitgestellt. Diese Flüchtlinge waren zum einen Bauern und zum anderen Handwerker aus der Textil- und Lederbranche.
Der Calvinismus, wegen dem die Menschen ausgewandert waren, basierte auf einer sittenstrengen, ernsthaften und sparsamen Lebensweise, gepaart mit einer streng ausgeübten Kirchenzucht. Schlicht ausgedrückt waren die Hugenotten „Andersgläubige“ gegenüber den einheimischen Protestanten und Katholiken. Dadurch bedingt lebten die Hugenotten anfangs in einer in sich geschlossenen Kolonie. Das Gemeindeleben wurde von der französischen Brauerei getragen, der 1700 das Brauerei-Privileg erteilt wurde und die zugleich steuerlich freigestellt wurde. Dennoch war es für die Immigranten anfangs nicht einfach in Halberstadt anzukommen: So ist zum Beispiel überliefert, dass in der ersten Zeit nach der Gründung der halberstädter Kolonie viele Hugenotten erkrankten, weil sie das grobe Gerstenbrot, den schweren Broyhan (Bier) und den rauen Brockenwind nicht vertrugen. Die Hugenotten erhielten dann die Erlaubnis ihr angestammtes Brot zu backen und das sogenannte „Halbbier“, das ihnen zusagte, zu brauen.
Die hugenottischen Bauern beackerten die ihnen überlassenen Felder rund um Halberstadt und trugen damit zur besseren Versorgung bei. Die Textil- und Lederfachleute errichteten neue Werkstätten und entwickelten Halberstadt zum Zentrum der deutschen Handschuhmacher. Diese Entwicklungen wurden von den brandenburgisch/preußischen Herrschern großzügig gefördert. Das traf übrigens auch auf Magdeburg zu, wo mit dem Beginn der Einwanderungswelle geschätzte 5 000 Hugenotten eine neue Heimat fanden. Es wird davon ausgegangen, das zu diesem Zeitpunkt mehr Hugenotten in Magdeburg lebten als Magdeburger und auch, dass Magdeburg ohne die Hugenotten wohl schwerlich wiederaufgebaut worden wäre.
Jedoch zurück zu Halberstadt: Die unterschiedliche Lebensauffassung und der unterschiedliche Glaube führten natürlich auch zu Unstimmigkeiten. Es ist daher nicht verwunderlich, dass die Hugenotten bestrebt waren ein eigenes Gotteshaus für ihre Gemeinde zu bekommen. Bereits 1713 bis 1717 wurde die Franzosenkirche im „Hugenottenstil“ erbaut. Den gab es tatsächlich in der Baugeschichte. Er zeichnet sich durch Nüchternheit und Klarheit aus, die Kirchen waren meistens im Sinnes des Predigersaales angelegt. Die hugenottischen Stadtanlagen zeichnen sich durch gerade und breite Straßen mit rechteckigen Häuservierteln aus, wie sie u.a. in Erlangen-Neustadt, Mannheim, Oberneustadt in Kassel, Magdeburg-Neustadt und explizit in Potsdam noch heute augenscheinlich sind.
Für den Bau der Halberstädter Franzosenkirche wurde eine Kollekte ausgeschrieben, in die alle französischen Kolonien einbezogen wurden. Spenden für die neue Kirche kamen unter anderem aus: Leipzig, Königsberg, Danzig, Stendal, Calbe, Cleve, Dresden, Brandenburg, Frankfurt/Oder, Cottbus, Braunschweig, Bremen, Neuhaldensleben, Magdeburg, Hamm, Minden, Hannover, Burg, Wesel, Genf, Zürich, Schaffhausen und Basel.
Die französische Gemeinde in Halberstadt entwickelte sich im Laufe des 18. Jahrhunderts prächtig. Damit meine ich insbesondere die Integrationsfähigkeit der Hugenotten. Von den Familien, die die Franzosen-Kolonie um 1700 begründet hatten, sind uns 43 namentlich bekannt. Dabei ist besonders zu erwähnen, dass von diesen französischen Namen im Jahr 1848 kein einziger mehr in dem halberstädter Einwohnerverzeichnis vermerkt war. Bei aller Wandlung von Personen und Namen in einem Zeitraum von knapp 150 Jahren ist das schon bemerkenswert. Es zeigt uns, dass die Hugenotten vollständig in der Stadtgemeinschaft aufgegangen waren. Die französische Gemeinde hatte in Halberstadt nur 109 Jahre bestanden, dann war die Integration vollständig abgeschlossen.
Es war einmal, so fangen fast alle Märchen an. Ich möchte Ihnen jedoch kein Märchen erzählen, sondern Ihnen von dem ersten Raketeneinsatz berichten.
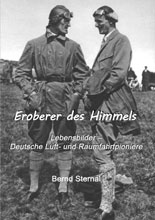 Es war einmal ein junger Pilot namens Rudolf Nebel, der 1894 in Weißenburg/Bayern geboren worden war. Er hatte bereits einige Semester Ingenieurswissenschaften an der Tu München studiert, als er mit dem Beginn des Ersten Weltkrieges als Soldat eingezogen wurde. Auf Grund seiner technischen Vorbildung wurde er ab Januar 1916 zum Jagdpiloten ausgebildet. Er diente unter Oberleutnant Hans Berr in der Jasta 5. Nach einem Luftgefecht schwer verletzt, kam Nebel in ein Lazarett. Dort hatte er Zeit um über seinen Luftkampf nachzudenken. Hatte er Fehler gemacht, was hätte er besser machen können, wie könnte er solch einer Situation beim nächsten Mal seinen Stempel aufdrücken? Er erkannte, dass es überaus nützlich wäre, die Angriffsdistanz während eines Luftkampfes vergrößern zu können., was jedoch mit den damals üblichen Maschinengewehrwaffen nicht möglich war. So begann er über neue Waffensysteme nachzugrübeln: Dabei kam ihm wieder in den Sinn, wie sein Mathematiklehrer einst von alter chinesischer Kriegsführung mittels Raketen berichtet hatte. Demnach setzte die Chinesen Im Krieg gegen die Mongolen, in der Schlacht von Kaifeng im Jahr 1232 eine Art Rakete ein. Sie sollen eine Vielzahl simpler, von Schwarzpulver angetriebener Flugkörper auf die gegnerischen Mongolen abgefeuert haben. Eine Idee, die Rudolf Nebel faszinierte und die er ausprobieren wollte. Noch im Lazarett fertigte er Zeichnungen und Skizzen und stellte Berechnungen an. Wieder genesen und zurück bei seiner Einheit, machte er sich ans Werk. Für sein Raketenprojekt verwendete er simple Ofenrohre, die er mit Infanterie-Signalraketen bestückte. Die so hergestellten Raketenwerfer montierte er unter die Tragflächen seines Halberstadt-Doppeldeckers. Vom Zündmechanismus verlegte er ein Kabel in sein Cockpit, und installierte einen Zündschalter, an den er das Kabel anschloss.
Es war einmal ein junger Pilot namens Rudolf Nebel, der 1894 in Weißenburg/Bayern geboren worden war. Er hatte bereits einige Semester Ingenieurswissenschaften an der Tu München studiert, als er mit dem Beginn des Ersten Weltkrieges als Soldat eingezogen wurde. Auf Grund seiner technischen Vorbildung wurde er ab Januar 1916 zum Jagdpiloten ausgebildet. Er diente unter Oberleutnant Hans Berr in der Jasta 5. Nach einem Luftgefecht schwer verletzt, kam Nebel in ein Lazarett. Dort hatte er Zeit um über seinen Luftkampf nachzudenken. Hatte er Fehler gemacht, was hätte er besser machen können, wie könnte er solch einer Situation beim nächsten Mal seinen Stempel aufdrücken? Er erkannte, dass es überaus nützlich wäre, die Angriffsdistanz während eines Luftkampfes vergrößern zu können., was jedoch mit den damals üblichen Maschinengewehrwaffen nicht möglich war. So begann er über neue Waffensysteme nachzugrübeln: Dabei kam ihm wieder in den Sinn, wie sein Mathematiklehrer einst von alter chinesischer Kriegsführung mittels Raketen berichtet hatte. Demnach setzte die Chinesen Im Krieg gegen die Mongolen, in der Schlacht von Kaifeng im Jahr 1232 eine Art Rakete ein. Sie sollen eine Vielzahl simpler, von Schwarzpulver angetriebener Flugkörper auf die gegnerischen Mongolen abgefeuert haben. Eine Idee, die Rudolf Nebel faszinierte und die er ausprobieren wollte. Noch im Lazarett fertigte er Zeichnungen und Skizzen und stellte Berechnungen an. Wieder genesen und zurück bei seiner Einheit, machte er sich ans Werk. Für sein Raketenprojekt verwendete er simple Ofenrohre, die er mit Infanterie-Signalraketen bestückte. Die so hergestellten Raketenwerfer montierte er unter die Tragflächen seines Halberstadt-Doppeldeckers. Vom Zündmechanismus verlegte er ein Kabel in sein Cockpit, und installierte einen Zündschalter, an den er das Kabel anschloss.