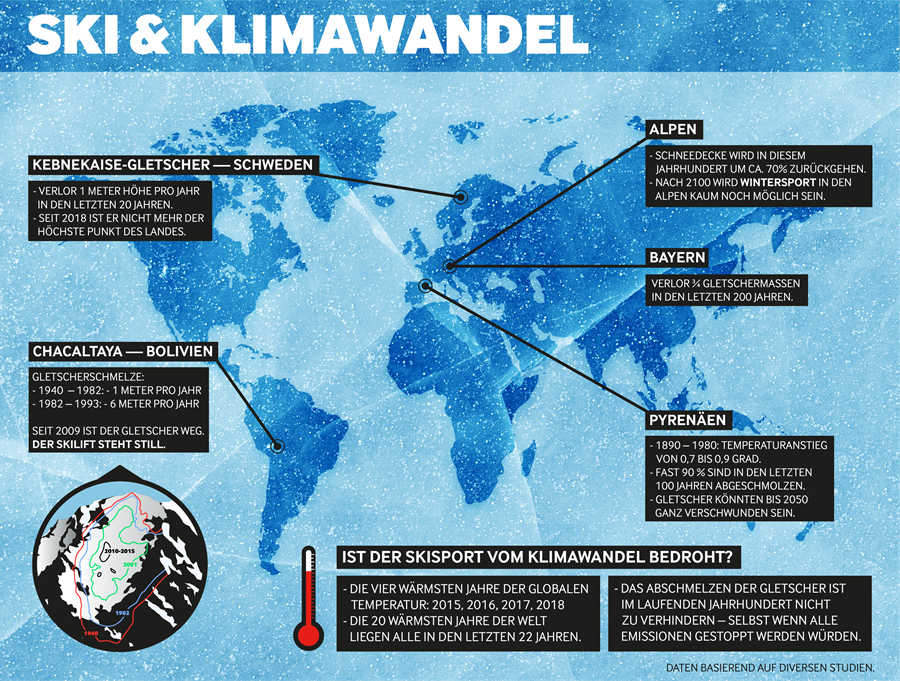Der Harz war über Jahrhunderte Reichsbannforst der Könige. Im Sachsenspiegel, der wohl in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts teilweise auf dem Falkenstein im Selketal entstand, wurde das Wild geschützt, nicht aber Bären, Wölfe und Luchse.
Damals, im Mittelalter, waren sie also noch im Harz zu Hause, die Bären, Wölfe & Co. Mit der Entwicklung der Feuerwaffen verschob sich das natürliche Gleichgewicht in der Natur erheblich. Auch die großen Raubtiere waren dem Menschen nun unterlegen und konnten über größere Entfernungen erlegt werden. Der Reihe nach verschwanden sie aus dem Harz, wurden vom Menschen ausgerottet.

Zuerst traf es den Bären, das größte Raubtier unserer Heimat. Noch im 16. Jahrhundert war er nicht selten, wie uns mehrere Quellen überliefern. So wurden im Wernigeröder Forst 1526 noch 3 Bären gefangen. Nachdem der Bär zum Ende des 16. Jahrhunderts bereits stark dezimiert war, ließ der Braunschweiger Herzog Heinrich Julius zu Jagdzwecken wieder Bären aussetzen. Das half aber nicht mehr, denn 1696 wurde unterhalb des Ramberges bei Gernrode der angeblich letzte Bär erlegt. Ihm zu Ehren wurde an jener Stelle ein Denkmal errichtet, das als Bärendenkmal noch heute erhalten ist. Ob es jedoch wirklich der letzte Bär war, darf angezweifelt werden, denn im 18. Jahrhundert gab es erneut Nachrichten von weiteren erlegten Braunbären.

Etwa ein Jahrhundert später war auch die Gnadenfrist des Wolfes abgelaufen. Nachdem dieser Räuber sich nach dem Dreißigjährigen Krieg im Harz enorm vermehrt hatte und in Rudel für Angst und Schrecken sorgte, gab es seit Mitte des 18. Jahrhunderts kaum noch Informationen und Aufzeichnungen zu Isegrim. 1798 wurde der wohl letzte Wolf am Brocken erlegt. Nach aufwendiger Jagd war Graf Ferdinand von Stolberg-Wernigerode der erfolgreiche Schütze. Der Wolf war entsprechend zeitgenössischen Berichten „stark und feist“, wog 79 Pfund und war 5 Fuß hoch und 6 Fuß lang. Aber auch diese überkommene Nachricht vom Wolf ist nicht eindeutig, da angeblich bei Schwiederschwende im Mansfeldischen der letzte Wolf erlegt worden sein soll. Jedoch fällt auch dieses Ereignis in die Zeit gegen Ende des 18. Jahrhunderts. Welch große Bedeutung der Wolf einst im Harz für die Menschen gehabt hat, bezeugen noch heute die zahlreichen auf ihn zurückgehenden Orts- und Flurnamen wie z.Bsp.: Wolfshagen, Wolfsklippen, Wolfsberg, Wolfswarte, Wolfsbachtal usw.

Der dritte und letzte im Bunde war dann der Luchs. Auch dieser Großkatze wurde im 18. und 19. Jahrhundert endgültig die Lebensgrundlage entzogen. Wog ein 1649 erlegter Luchs noch stattlich 87 Pfund, so brachte der vorletzte erlegte Luchs im Jahr 1816, nur noch 53 Pfund auf die Waage. Und der letzte Harzer Luchs, der 1817 im Lautenthaler Revier von Förster Spellerberg erlegt wurde, wog sogar nur noch 41 Pfund. Auch hier, wie auch bei Bär und Wolf, hatten sich die letzten Vertreter ihrer Art in die unwegsamen Regionen des Brockenmassivs zurückgezogen, was ihnen aber letztendlich auch nicht das Überleben sicherte. Auch dem letzten Luchs wurde ein Denkmal gesetzt, das noch heute als „Luchsstein“ an einem Waldweg, der von Lautenthal nach Seesen führt, zu sehen ist.
Heute, knappe 200 Jahre später, ist der Luchs im Harz durch Wiederansiedlungsmaßnahmen erneut heimisch. Und auch der Wolf, der bereits in einigen Regionen Deutschlands eine neue Heimat gefunden hat, ist nun im Harz angekommen, wie ein erstes Foto vom September 2017 bezeugt. Isegrim ist wieder da und menschliche Hilfe braucht er nicht.
50 bis 70 Rudel soll es in Deutschland geben, die Anzahl der Tiere wir auf knapp 400 geschätzt. Ist das wirklich viel für ein Land mit der Größe Deutschlands? Diese Angaben sind jedoch sehr unterschiedlich und ich kann sie nicht verifizieren.
Der Bestsellerautor und erfahrene Förster Peter Wohlleben gibt an, dass es in Deutschland durchschnittlich 50 Rehe pro Quadratkilometer gibt. Hochgerechnet bedeutet das, dass in Deutschland etwa 18 Millionen Rehe leben. Wie häufig bekommen wir jedoch ein Reh zu Gesicht? Und wie groß ist die Wahrscheinlichkeit dann bei der genannten Wolfspopulation eines der scheuen Tiere zu Gesicht zu bekommen?
Dennoch sind die knapp 400 Wölfe in unserem Land ein regelrechtes Dauerthema in allen Medien. Und wie heute üblich, haben sich auch umgehend zwei konträre Gruppen gebildet: Wolfsbefürworter und Wolfsgegner.
Sobald eine Sache thematisiert wird, spielt sie auch in der Politik eine Rolle. Sogar Ministerpräsidenten finden die Zeit sich dazu zu äußern. So geschehen im Oktober 2017 durch Dr. Haseloff der eine Begrenzung der Ausbreitung des Wolfes fordert. Mit der Sachlage dürfte er nicht wirklich vertraut sein, sonst hätte er sich seinen Kommentar sicherlich gespart.
Man ist sich also auch in der Politik keinesfalls einig. Im Mai 2017 fand eine Umweltministerkonferenz der Bundesländer statt. Die Ressortchefs der Bundesländer gehen von einem „günstigen Erhaltungszustand“ von 1000 Wölfen in Deutschland aus. Übersetzt: Die Bundesrepublik verträgt etwa 1000 Tiere. Also mehr als eine Verdopplung der bisherigen Zahl.
Wir haben eine Natur die der Mensch in der Vergangenheit arg aus dem Gleichgewicht gebracht hat. Die drei großen Raubtierarten wurden ausgerottet, große Teile des Harzer Urwaldes gerodet, die Flüsse durch vielfältige bauliche Maßnahmen unter anderem für Fischwanderungen untauglich gemacht und der restliche Wald durch Nutzholzgewinnung geschwächt und vieles mehr.

Und nun kommt auch noch der böse Wolf zurück, reißt das Wild, tötet die Nutztiere und gefährdet die Menschen. Eine grausige Vorstellung, die vor allem Jäger und Nutztierhalter befällt und natürlich alle „Rotkäppchen“.
Die Anzahl der Jäger in Deutschland betrug 2016 etwa 362.000. Deren ureigenstes Interesse ist natürlich die Hege und Pflege ihres Wildes und daher kann der Jägerschaft die Wilddichte auch gar nicht groß genug sein – was verständlich ist, jedoch dem Wald und dem allgemeinen Gleichgewicht der Natur schadet. Die Wilddichte in Deutschland wird auf das 30 – 50 fache dessen geschätzt, was in einem natürlichen Urwald üblich wäre.
Wolfsrudel benötigen, wie die anderen großen Beutegreifer auch, ein großes Revier. Beim Wolf umfasst diese durchschnittlich 200 – 300 Quadratkilometer. Bezogen auf das Gesamtgebiet Deutschlands würden also Reviere für etwa 1.430 Wölfe zur Verfügung stehen.
In der Regel geht der Wolf dem Menschen aus dem Weg. Nur wenn wir ihn füttern oder anders an uns zu binden versuchen, entsteht direkter Kontakt und auch potentielle Gefahr.
Wie viele verwilderte Hund es in Deutschland gibt ist nicht bekannt. Bekannt ist hingegen, dass jährlich etwa 40. 000 dieser Hunde von Jägern erschossen werden. Zudem werden die jährlichen Bissattacken von Hunden auf Menschen auf 30. 000 bis 50. 000 geschätzt. Ich habe selbst einen Hund! Kommt deshalb der Hund in Misskredit, obwohl er erheblich gefährlicher für den Menschen ist als der Wolf?
Wie der Wolf, vom Menschen wiederangesiedelt, ein ganzes Ökosystem positiv verändern kann, ist in zahlreichen wissenschaftlichen Studien des Yellowstone-Nationalparks beeindruckend nachzulesen.
Wir sollten uns freuen, dass der Wolf sich wieder bei uns wohl fühlt. Er ist, im Gegensatz zu Waschbär, Marderhund, Muffelwild, Nutria usw. hier zuhause. Und er wird wohl unsere Wälder nicht leerfressen, die Viehzüchter nicht um ihre Existenz bringen und auch keine Menschen gefährden.
Vor allen Dingen sollte die Politik nicht so viel lamentieren, sondern einfach handeln. Es sollte doch wirklich kein Problem sein, Viehhalter schnell, großzügig und unbürokratisch zu entschädigen, wenn ein Wolf Tiere gerissen hat, auch wenn die Sachlage nicht eindeutig ist. Denn sicherlich sind oftmals auch Fuchs, verwilderte Hunde oder Luchse die Übeltäter, was aber den Viehhalter keinesfalls in eine andere Situation bringt. Eine bedeutende Gruppe der Wolfsgegner wäre so befriedet. Und es wäre gerecht, da dem Viehhalter das Recht fehlt seine Herde mit Schusswaffen zu verteidigen.